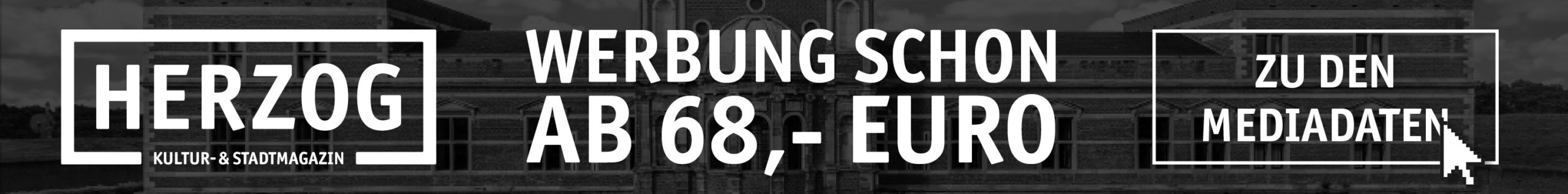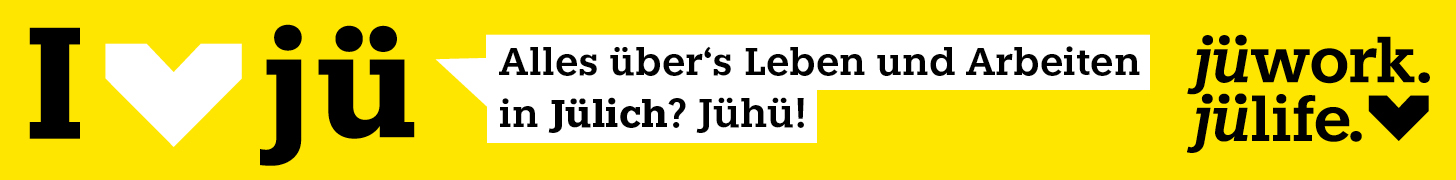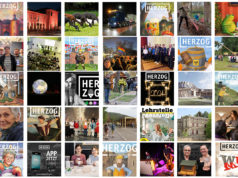Als Tricia Tuttle 1991 ihre Abschlussarbeit über den Film „Poison“ schrieb, ahnte sie noch nicht, dass sie eines Tages den Regisseur des Films, Todd Haynes, als Festivalintendantin auf der Berlinale begrüßen würde. Und nicht nur das, der Regisseur, der für anspruchsvolle und erfolgreiche Filme wie „Carol“ oder „Vergiftete Wahrheit“ zeichnete, wurde auch Präsident der Internationalen Wettbewerbsjury. So schloss sich dieses Jahr für Tuttle, der 55jährigen Leiterin der 75. Berlinale, die kurz davor noch das London Film Festival leitete, auch beruflich ein Kreis.
Es schneite in Berlin, als sich in einem kalten Februar internationale Stars auf dem roten Teppich der Berlinale einfanden – Jessica Chastain, Timothy Chalamet, Robert Pattinson oder Ethan Hawke flanierten im Blitzlichtgewitter, so wie auch Tilda Swinton, Empfängerin des Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Bei der gegenüber dem Vorjahr fast halbierten Filmmenge waren die Tickets begehrter als 2024, und auch schwerer zu buchen – denn nun kann man das nur noch online tun; die Kinosäle waren äußerst gut gefüllt.
Tilda Swintons Verbindung zur Berlinale geht zurück auf das Jahr 1986. Sie hatte als 25jährige erstmalig an einem Filmfestival teilgenommen, als Lena in Derek Jarmans Film „Caravaggio“, der den Silbernen Bären gewann. Seither war sie in 26 Filmen bei der Berlinale dabei, 2009 sogar Präsidentin der Internationalen Jury. In Ihrer Dankesrede zur Eröffnung der 75. Berlinale setzt sie insbesondere auf die Hoffnung, die in politisch tumultartigen Zeiten bitter notwendig erscheint: „Das Unmenschliche wird unter unseren Augen verübt. Ich bin hier, um das Übel beim Namen zu nennen, ohne zu zögern oder zu zweifeln, und um all jenen meine unerschütterliche Solidarität zu bekunden, die die inakzeptable Selbstgefälligkeit unserer gierigen Regierungen erkennen, die sich mit Planetenzerstörern und Kriegsverbrechern gut stellen, woher auch immer sie kommen… Es lebe das Kino und seine unendliche Verheißung – ein Licht in der Dunkelheit, das nie erlischt. Lasst uns nach oben schauen.“
19 Wettbewerbsfilme präsentierte die Jury, vier aus Frankreich, drei aus den USA, jeweils zwei aus China und Deutschland, und je einen aus Österreich, England, Norwegen, Argentinien, Brasilien, Rumänien, Südkorea, sowie eine ukrainische Dokumentation. Den Goldenen Bären hat die liebliche Teenager-Romanze „Drommer – Dreams (Sex, Love)“ gewonnen. Ein Mädchen verliebt sich in ihre Lehrerin und bringt ihre Geschichte zu Papier. Diese Story entwickelt ein Eigenleben und löst zugegeben köstliche Diskussionen zwischen Mutter, Großmutter und der Lehrerin aus. Und wie schön, sie hat ein Happy End. Kein Film, der den höchsten Preis der Berlinale verdient, aber einfach nett anzusehen ist.
Die drei amerikanischen Filme überzeugten sehr durch ihre künstlerische Risikobereitschaft und ihre solide gebauten Geschichten. Vor allem „If I Had Legs I’d Kick You“ der jungen Regisseurin Mary Bronstein hatte filmische Elemente, die auf das traumatisierte Innenleben der Hauptdarstellerin Linda eingehen – einer überforderten Mutter eines kranken Kindes. Die Australierin Rose Byrne spielte die Hauptrolle und gewann dafür einen Silbernen Bären. Aber auch Michel Francos Film „Dreams“ über das Aufeinanderprallen zweier Welten und das Machtgerangel in einer Liebesgeschichte zwischen einer nicht mehr ganz jungen superreichen Amerikanerin, gespielt von Jessica Chastain, und einem blutjungen mexikanischen Balletttänzer, der trotz seiner Ausweisung immer zu ihr in die USA zurückwill, koste es, was es wolle. Und schließlich „Blue Moon“ mit dem exzentrischen pansexuellen Lorenz Hart, Texter von bekannten Liedern wie eben „Blue Moon“, „My Funny Valentine“ oder „Isn’t It Romantic“. An einem schicksalshaften Abend in „Sardi’s“ Bar im März 1943 muss er die zwei tiefsten Verletzungen seines Lebens verkraften – ein sehr schöner Film von Richard Linklater, einmal mehr mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Die beiden letzten Filme gingen ohne Preise nach Hause, schade.
Die deutschen Filme überzeugten auch – vor allem der Film „Yunan“ durch das fantastische Naturspektakel auf einer deutschen Insel, einer „Hallig“, über die ein Sturm fegt, der sich im inneren Tumult des Hauptcharakters Munir widerspiegelt. Der in Deutschland lebende syrische Filmemacher Ameer Fakher Eldin wollte sich darin mit dem Verlust der Heimat auseinandersetzen. Hanna Schygulla spielt eine Nebenrolle – welch ein schönes Wiedersehen mit der Schauspielerin, die bereits 1979 einen Silbernen Bären für ihre Darstellung der Maria Braun erhielt.
Der rumänische Film „Kontinental ‘25“ vom einstigen Berlinale-Gewinner und Ex-Juror Radu Jude wurde mit Neugier erwartet, war aber eine Enttäuschung. Die irrationale Selbstgeißelung einer Gerichtsvollzieherin nach dem Selbstmord eines Obdachlosen soll absurd wirken, ist aber nur eine misslungene Komödie. Mit dem Silbernen Bären für das Beste Drehbuch in der Hand sagte der Filmemacher, das Schreiben von Drehbüchern liege ihm gar nicht.
Nicht unerwähnt will ich den deutschen Eröffnungsfilm lassen – „Das Licht“ von Tom Tykwer, der außer Konkurrenz lief. Deutsches Verschwendertum trifft auf Flüchtlingsdrama, Mystik trifft auf virtuelle Gamingwelten, und als Krönung: die stroboskopische Lichttherapie, die alles heilt. Das überladene zweieinhalbstündige Drama ohne erkennbare Botschaft glänzt nur durch poetische Bildgebung und sphärische Musik.
Es wird einem ganz anders, wenn man sich für vier Stunden in einen Film über das Sterben setzen soll, aber für die Dokumentation „Palliativstation“ von Philipp Döring lohnt es sich. Man vergisst die Zeit, verfolgt gebannt das Geschehen, und am Ende fühlt man sich wie nach einer innerlichen warmen Dusche. Auf eigene Kosten realisierte der junge Döring diesen tief menschlichen Film, der ohne Musik oder Dialoge auskommt. Er zeigt den Alltag in der Palliativstation im Berliner Franziskus-Krankenhaus. Den Patienten wird dort ein immenser Raum eröffnet, der von behutsamer Ehrlichkeit, aber eben auch von tiefem Verständnis und einer wohlwollenden Lösungsbereitschaft für alle Sorgen und Ängste der Betroffenen gekennzeichnet ist. Ein Ort, an dem man Mensch sein darf.
Und schließlich zur Doku „Die Möllner Briefe“. Ibo Arslan ist ein siebenjähriger kleiner Junge, als eines nachts die Wohnung seiner Familie in Flammen aufgeht. Er kauert sich im rauchenden brennenden Zimmer unter einen Tisch, klammert sich an ein Tischbein und hofft auf Rettung. Es ist das Jahr 1992. In Mölln haben zwei rechtsradikale Jugendliche mehrere Migrantenwohnungen in Brand gesetzt und damit drei Menschen getötet – eine 51jährige Frau und zwei Mädchen, die 10jährige Yeliz und die 14jährige Ayse – sie sind Ibos Großmutter, Schwester und Cousine.
Schon wenige Tage nach dem Anschlag beginnen bei der Stadt Mölln Briefe einzutrudeln – Beileidsbekundungen, Anteilnahmen, Karten, von Kindern gezeichnete Bilder, Worte voller Trauer, Mitgefühl und Scham. Die Stadt Mölln öffnet sie, liest sie, beantwortet hunderte davon. Aber die eigentlichen Adressaten bekommen diese Briefe nie zu Gesicht. 27 Jahre später werden sie von einer Studentin durch Zufall im Stadtarchiv Mölln entdeckt. Sie informiert die nichts ahnenden Betroffenen, ein behäbiger bürokratischer Prozess setzt sich in Gang. Selbst jetzt, nach über 30 Jahren, finden Bürgermeister und Stadtarchivar immer noch nicht die richtigen Worte, um diese große Ungerechtigkeit zu beseitigen. Eine unbedingt sehenswerte Dokumentation, die bereits mit dem Amnesty Filmpreis ausgezeichnet wurde.
So kann man als Resümee sagen, dass diese 75. Berlinale nicht offensiv politisch war, aber zeigte, wie sich das Politische im Alltag wiederfindet. Durch Mauern, durch Geldgier, durch Hetze und Spaltung. Und so erreichen wir, auch durch das Kino, die Erkenntnis, dass es auf unsere Menschlichkeit ankommt, um dem politischen Chaos ein Ende zu setzen und um wieder als Menschen zueinander zu finden.