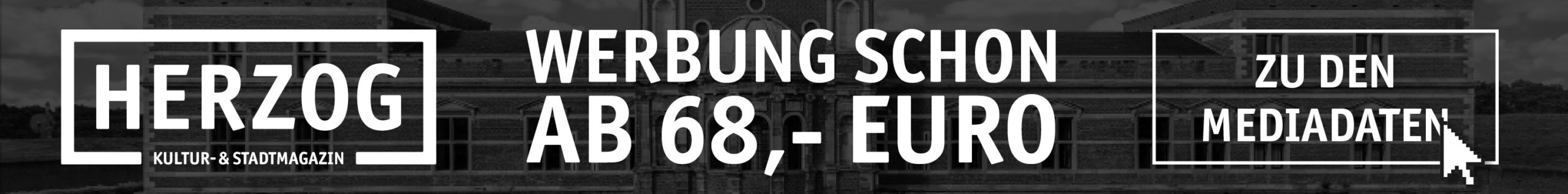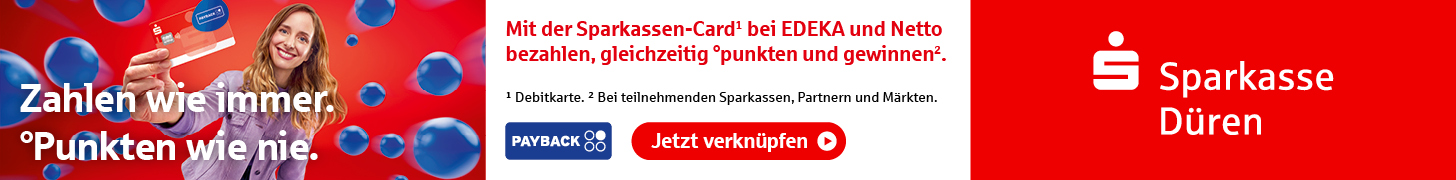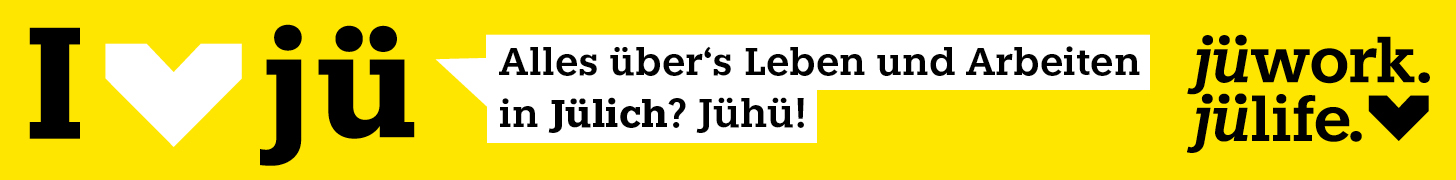Acht Tage lang haben sich Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren über unterschiedliche Themen informieren können und Projekte dazu entwickelt. Die Stipendiaten aus dem Regierungsbezirk Köln, die sich allein über Interesse für und nicht über Noten in naturwissenschaftlichen Fächern qualifiziert haben, befassen sich tagsüber mit Forensik und Verbrechensermittlung, nachhaltigem und energieeffizientem Bauen sowie „Kunst zum Anfassen“ – wie Kunst für Menschen mit Sehbehinderungen erfahrbar ist oder sein könnte. Abends gibt es Vorträge zu unterschiedlichen Themen für Alle. Obwohl der vordergründige Fokus auf MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) liegt, sind – allen Klischees zum Trotz – etwa zwei Drittel der Jugendlichen weiblich.
Die Unterschiedlichkeit in den Charakteren der Jugendlichen ist schon in den Vorträgen zu spüren, mit denen die Jugendlichen den anderen ihre Themen vorstellen. Zwischen „kahoot“-Quiz, klassischem Vortrag mit SMART Board-Unterstützung und interaktivem Einfühlversuch mit Knetmasse, Bildbeschreibung und Gegenstände Ertasten mit simulierter Sehbehinderung sind die Ansätze der Wissensvermittlung ganz unterschiedlich. Doch sind auch die Zuhörenden immer mit Interesse dabei – es werden viele Rückfragen gestellt und fleißig mitgeschrieben. „Wie hieß das Verfahren von der letzten Folie nochmal?“, wird nachgefragt, oder ganz praktisch: „Wieso haben denn die Ziegel Löcher, wie funktioniert das?“

Das Ziel der Veranstaltung ist es, so Na Young Shin-Vogel als Referentin Bildung der Victor Rolff Stiftung, interdisziplinäres Denken und Arbeiten zu fördern. Darum ist auch der Zusatz „Ferienakademie“ weggefallen und die „Sommerwerkstatt“ geblieben. Häufig sei es eine Hemmschwelle, wenn im schulischen Kontext, über Noten in MINT-Fächern gedacht würde. Dabei sei das Verständnis dafür, wie die individuellen Stärken eingebracht werden können, wichtiger. Ein Jugendlicher habe zum Beispiel nach einem abendlichen Vortrag über den Druck von Organen gesagt, er hätte lieber mehr zum biologischen Aspekt gehört, denn der technische sei ihm bekannt. Sie habe daraufhin entgegnet, dass er sich dann ja überlegen könne, wie er sein Wissen im Gruppenprojekt anwenden könne.

Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Jugendlichen bis in die Abendstunden diskutieren – mit den Vortragenden, aber auch anderen Erwachsenen und unter einander und zu den unterschiedlichsten Themen, wie Shin-Vogel beeindruckt erzählt. Auch Weltprobleme und Kritik am Schulsystem seien dabei.