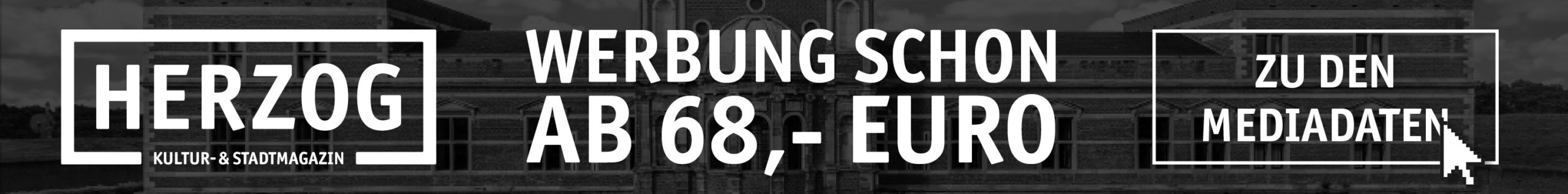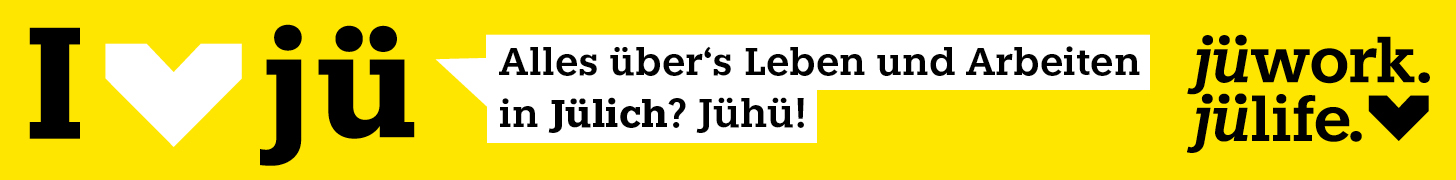Die komplexen physikalischen Prozesse, die beim Entstehen dieser Wetterereignisse ablaufen, untersucht die Helmholtz-Initiative MOSES, an der auch das Forschungszentrum Jülich beteiligt ist. Ziel der Messkampagne „Swabian MOSES“ ist es, die Ursachen, Auswirkungen und Wechselwirkungen hydro-meteorologischer Extreme ganzheitlich zu untersuchen. Im Untersuchungsgebiet in Baden-Württemberg treten sowohl Gewitter als auch Hitze- und Dürreperioden häufig auf.
Um die Auswirkungen meteorologischer und hydrologischer Extreme auf die langfristige Entwicklung von Erd- und Umweltsystemen zu untersuchen, bauen neun Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft das mobile und modular einsatzfähige Beobachtungssystem MOSES (Modular Observation Solutions for Earth Systems) auf, das bis 2022 vollständig einsatzfähig sein soll. Testkampagnen sind ein wichtiger Teil dieser Aufbauarbeit, denn es gilt die neuen Messsysteme im mobilen Einsatz zu prüfen, weiterzuentwickeln und aufeinander abzustimmen. Zwei dieser Kampagnen zu unterschiedlichen Fragen und in unterschiedlichen Untersuchungsgebieten sind bislang für das Jahr 2021 geplant – im Bereich der Schwäbischen Alb und auf der Elbe.
Die Messkampagne „Swabian MOSES“ läuft im Bereich der Schwäbischen Alb und des Neckartals in Baden-Württemberg bis voraussichtlich Mitte September und wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert. In deren Mittelpunkt stehen zwei hydro-meteorologische Extreme – Trockenheit und Starkniederschlag. So führte die Häufung von mehrwöchigen Trockenperioden in den Jahren 2018 bis 2020 dazu, dass im letzten Jahr der Grundwasserspiegel auf einen historischen Niedrigstand sank und viele Flüsse ein ausgeprägtes Niedrigwasser führten – mit erheblichen Einschränkungen für Schifffahrt, Bewässerung und Kraftwerkskühlung.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Stratosphärenforschung am Forschungszentrum Jülich lassen als Partner der Kampagne Ballonsonden bis in 35 Kilometer Höhe steigen, um unter anderem zu ermitteln, wie sich Gewitter langfristig auf das Klima auswirken. Sie untersuchen den Spurengastransport durch Gewitter in die obere Troposphäre – die unterste Schicht der Erdatmosphäre – oder sogar in die darüber liegende Stratosphäre. Dazu nutzen sie Wasserdampf-, Ozon- und Wolkenmessinstrumente und analysieren Luftproben mithilfe eines AirCores (ähnlich dem Prinzip eines Eisbohrkerns) auf Spurengase wie Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO) und Methan (CH4).
Mit verschiedenen Messsystemen beteiligt sind neben dem KIT und dem Forschungszentrum Jülich das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) aus Leipzig, die Universität Hohenheim, die Eberhard Karls Universität Tübingen, die Technische Universität Braunschweig, das Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie der Deutsche Wetterdienst (DWD).