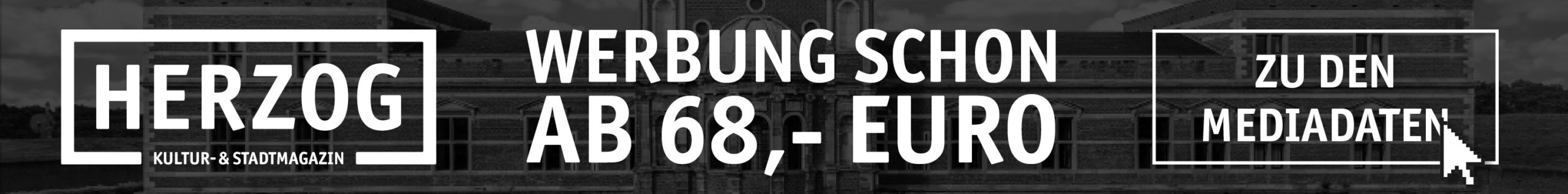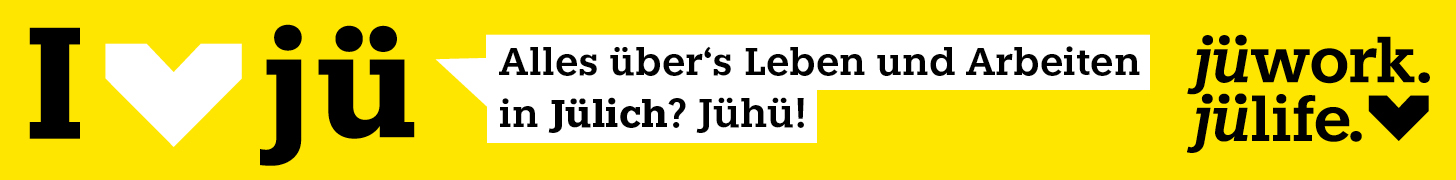Grundsätzliches zuerst: „Stolpersteine“ erinnern an das Schicksal der Menschen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. So hat es der Künstlers Gunter Demnig festgelegt, der 1992 mit der Verlegung von Stolpersteinen begonnen hat. Das sind Menschen jüdischen Glaubens, aber auch diejenigen, die wegen ihrer politischen Überzeugung, sexuellen Ausrichtung deportiert wurden – oder als „unerwünschte Subjekte“. Zweiter Punkt: Sie werden dort verlegt, wo diese Menschen ihren letzten, freiwillig gewählten Wohnort hatten. Und letztlich: Gegen den ausdrücklichen Wunsch lebender Nachfahren, soll eine Stolperstein-Verlegung nicht vorgenommen werden. Vorgegebene Ziellinie der Projektinitiatoren war es, Ende des Jahres die ersten Stolpersteine in Jülich zu verlegen.
In Ihrer Vorlage, Frau Richter, sprechen Sie von 100 Stolpersteinen für Jülich. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Susanne Richter: Erstmal kennen wir die Bevölkerungszahlen. Um 1930 herum gab es etwa 100 Bewohner jüdischen Glaubens in der Stadt. Ich habe im Gedenkbuch des Bundesarchivs nach Menschen gesucht, die in Jülich gelebt haben und daraus eine Liste generiert – ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit. „Stolpersteine“ würdigen Menschen in dem Ort, an dem sie ihren letzten frei gewählten Wohnort hatten. In diesem Gedenkbuch sind aber zum Beispiel emigrierte Familien nicht drin. Das ist schade, weil aus Jülich sehr viele emigriert sind und das haben diese Familien ja auch nicht freiwillig getan.
Wie könnte man diese „Lücken“ füllen?
Susanne Richter:Das Problem ist, dass wir die Personenmeldekarteien nicht im Jülicher Stadtarchiv haben. Darin würde nämlich nicht nur der Haushaltsvorstand stehen, sondern auch alle Familienangehörigen. In den Meldekarteien, die wir haben, ist nur der Haushaltsvorstand eingetragen. Das heißt, wenn ein erwachsener Sohn oder eine erwachsene Tochter mit im Haushalt gelebt hat, tauchen sie darin nicht auf.
Gibt es noch eine Chance, diese wichtige Kartei einzusehen?
Susanne Richter:Aus der Personenmeldekartei wurden alle Karten von Juden entfernt. Hintergrund ist nicht, dass irgendetwas vertuscht werden sollte, sondern dass nach dem Krieg diese Karteien genutzt wurden, um die Wiedergutmachungsverfahren anstoßen zu können. Ich muss nochmal im Bürgerbüro nachhören, ob sie möglicherweise doch noch im Rathaus verwahrt wird.
Viele haben Bedenken gegenüber dem Projekt wegen der angedachten schnellen Umsetzung. Bis Jahresende sollen die ersten Stolpersteine verlegt sein. Habe ich das richtig verstanden?

Susanne Richter:Grundsätzlich wird es ein Projekt sein, das über Jahre läuft. Ich merke ja auch selbst, dass selbst für den kleinen Personenkreis, den sich die Projektgruppe vom Gymnasium Overbach ausgesucht hat, der Aufwand sehr groß ist. Es geht ja nicht darum, „einfach“ einen Stein zu verlegen, sondern darum, diesen Menschen wirklich gerecht zu werden und auch deren Biografie zu verfolgen.
Welche Formate sind vorstellbar?
Susanne Richter:Es sollen möglichst Texte verfasst werden. Es sollte immer eine Kurzbiografie zu den Personen geben: Aus welcher Familie sie stammen, wer die Eltern waren und wo sie zur Schule gegangen sind, welchen Beruf sie ausgeübt haben. Zu jeder Person soll möglichst viel herausgefunden werden. Diese Text werden dann in der Stolpersteine-App des WDR hinterlegt, so dass die Menschen wieder ein Gesicht bekommen. Wir hätten eine Chance, bei der Erinnerungskultur einen Schritt nach vorne machen. Deshalb wäre es mir auch wichtig, dass die Schüler selber Konzepte entwickeln, wie sie das Thema vermitteln wollen. Jede Schule, jede Gruppe sollte ihre Form finden können – ob sie einen Podcast machen wollen, einen kleinen Film oder eine Graphic Novel. So können die Jugendlichen Verantwortung übernehmen für das, was sie recherchiert haben. Denkbar wäre auch, dass Schulen Patenschaften übernehmen für Stolpersteine.
Das Ziel ist eine Nachhaltigkeit des Projektes?
Susanne Richter:Ja. Wichtig wäre mir, dass das Material, das erarbeitet wurde, auch in den Schulen eingesetzt wird. Wenn man dann noch schaffen würde, dass es vielleicht Kontakt gibt zu Nachfahren, zu Familienangehörigen, wäre das noch einmal mal eine zusätzliche Ebene der Erinnerung, die sich ergeben könnte. Das wäre wunderbar.
Gibt es schon weitere Schulen, die sich für da Stolpersteine-Projekt gemeldet haben?
Susanne Richter:Der Rotary Club hat alle weiterführende Schulen angeschrieben und ins Stadtarchiv eingeladen. Im Hintergrund haben sich auch schon Lehrer untereinander vernetzt. Jetzt soll das organisatorische besprochen werden und vielleicht schon einmal geschaut werden, welche Schule sich mit welcher Familie beschäftigen möchte. Es gibt zum Beispiel Schülerinnen des Mädchengymnasiums die Jüdinnen waren. Da liegt es ja nahe, dass das Mädchengymnasium sich eventuell mit diesen Jüdinnen beschäftigen möchte. Vielleicht kann auch schon grob eine Zeitschiene festgelegt werden. Die Schulen können das Projekt nicht in den laufenden Unterricht einbinden. Das heißt, sie brauchen Projektkurse oder AGs. Außerdem finde ich, dass grundsätzlich viele daran beteiligt werden sollte. Ich möchte gerne, dass die Projekte im Stadtarchiv zusammenlaufen, damit wir den Überblick behalten.
Sie unterschätzen den Aufwand?
Susanne Richter:Völlig. Auch für uns im Archiv ist es ein großer Aufwand. Sicherlich ist vieles schon recherchiert, aber wir müssen dann nochmal genauer hingucken. Wir müssen im Grunde alles das, was die Schüler erforschen „vorforschen“: Material heraussuchen, um es zur Verfügung zu stellen, die Jugendliche ein bisschen mit anleiten. Sie sollen letztlich selbst zu Forschern werden.