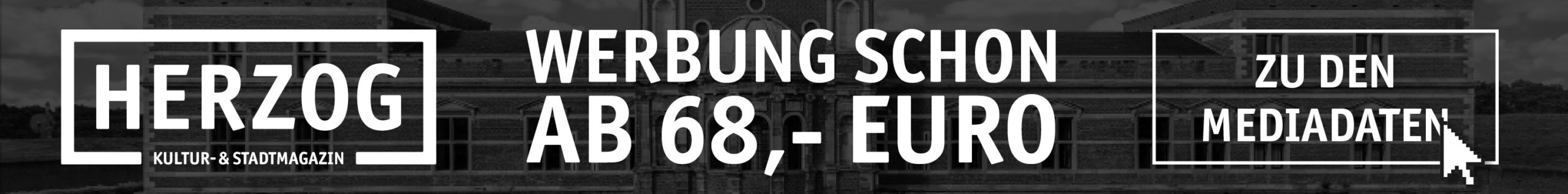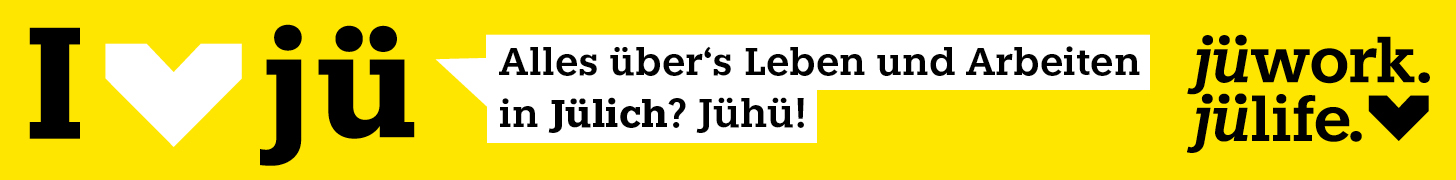SouthTRAC ist der offizielle Name einer Messkampagne mit dem deutschen Forschungsflugzeug HALO über der Südspitze Südamerikas, die im November endete. Im Zentrum stand der Klimawandel in der Südhemisphäre. Mitarbeiter des Jülicher Instituts für Stratosphäre sowie des Zentralinstituts für Engineering, Elektronik und Analytik waren an der Kampagne beteiligt. Prof. Martin Riese, Dr. Jens-Uwe Grooß und Dr. Peter Preusse über die Kampagne und erste wissenschaftliche Erkenntnisse.
Prof. Martin Riese, Direktor des Instituts für Stratosphäre, über die Hintergründe der Messkampagne und erste Ergebnisse.


 Die Messkampagne SouthTRAC über der Südspitze Südamerikas ist abgeschlossen, HALO zurück in Oberpfaffenhofen. Was waren die wissenschaftlichen Ziele, und wie fällt ein erstes Resümee aus?
Die Messkampagne SouthTRAC über der Südspitze Südamerikas ist abgeschlossen, HALO zurück in Oberpfaffenhofen. Was waren die wissenschaftlichen Ziele, und wie fällt ein erstes Resümee aus?
Martin Riese: Das Hauptziel der Kampagne war die Untersuchung klimarelevanter Prozesse in der südlichen Hemisphäre. Unsere Messungen waren ein voller Erfolg: Rio Grande an der Südspitze von Feuerland hat sich als ein ideales natürliches Labor erwiesen. Das Gebiet ist ein weltweiter Hotspot für Schwerewellen, die mit dem Polarwirbel wechselwirken und dadurch das regionale Klima beeinflussen. Durch die Nähe zum Polarwirbel war der Ort auch ideal für die Untersuchung der chemischen Prozesse, die bei der Erholung des Ozonlochs und bei Ozon-Klima-Wechselwirkungen eine wichtige Rolle spielen.
Welche Messinstrumente kamen zum Einsatz?
Martin Riese: Ein zentrales Messgerät an Bord von HALO war das Infrarotspektrometer GLORIA, eine gemeinsame Entwicklung des Forschungszentrums Jülich und des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Instrument stellt quasi die Kombination einer räumlich hochauflösenden Kamera mit einem Infrarotspektrometer dar, das die Wärmestrahlung der Atmosphäre analysiert und verschiedene Spurengase anhand ihres spektralen „Fingerabdrucks“ identifiziert. Im Rahmen von SouthTRAC haben wir dreidimensionale Messungen atmosphärischer Temperaturschwankungen durch Schwerewellen gemessen, die in dieser Ausprägung bisher noch nicht gesehen wurden.
Ein weiteres Instrument an Bord war AMICA, mit dem sich Spurenstoffe in der Atmosphäre messen lassen. Mit den hochgenauen Messungen zielten wir vor allem auf Spurengase wie Carbonylsulfid (OCS) und Kohlenmonoxid (CO), die bei der Verbrennung von Biomasse entstehen. In der Tat waren die Fahnen dieser Spurengase im September extrem ausgeprägt und ließen sich noch gut bis in 14 Kilometer Höhe über dem Atlantik nachweisen. Schließlich haben unsere Messungen mit dem Instrument FISH wichtige Informationen über den Transport und die Verteilung von Wasserdampf geliefert, dem wichtigsten natürlichen Treibhausgas.
Dr. Peter Preusse über Schwerewellen und ihre Rolle im Klimageschehen
Was ist die besondere Wirkung von Schwerewellen?

Was ergibt sich daraus für die Forschung?
Peter Preusse: Ein Highlight war ein Messflug, bei dem wir eine besonders starke Schwerewelle mit einer horizontalen Länge von etwa 200 Kilometern zweimal umflogen und mit dem GLORIA-Instrument tomographisch vermessen haben. Die Tomographie erlaubt die Ableitung der dreidimensionalen Wellenstruktur und erstmals auch deren zeitlicher Veränderung. In Kombination mit Messungen von Wind und Temperatur haben wir so einen einzigartigen Datensatz aufgenommen, der eine detaillierte Untersuchung der Ausbreitung von Schwerewellen zulässt. Diese Messungen werden uns helfen, die Dynamik des Polarwirbels besser zu verstehen und bestehende Probleme in Klimamodellen zu mindern.
Dr. Jens-Uwe Grooß über die Belastung der Atmosphäre durch Busch- und Waldbrände
Ein wichtiges Messziel der Kampagne war die Beobachtung von Luftmassen, die durch die Verbrennung von Biomasse verschmutzt wurden.

Erste wichtige Erkenntnisse?
Jens-Uwe Grooß:Unsere Spurengasmessungen geben wichtige Einblicke in die Chemie des Ozonabbaus in der polaren Stratosphäre. Auch wenn diese in ihren Grundsätzen verstanden ist, gibt es noch offene Fragen. In den letzten drei Jahrzehnten gab es kaum Messungen der chemischen Zusammensetzung der Luft des Polarwirbels über der Antarktis. Bei drei Flügen von Rio Grande aus konnten wir diese Luft direkt untersuchen. Ein wichtiges Ergebnis: Der Ozonabbau ist in diesem Jahr deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Die Messungen zeigten aber auch, dass der Abbau trotz des kleineren Ozonlochs in diesem Jahr zum Teil immer noch über 75 Prozent beträgt.