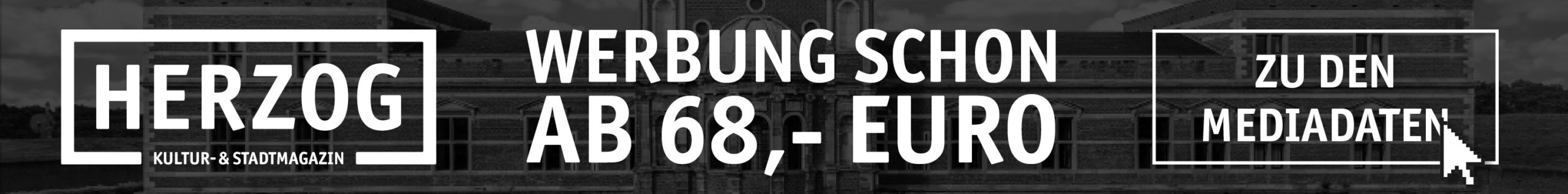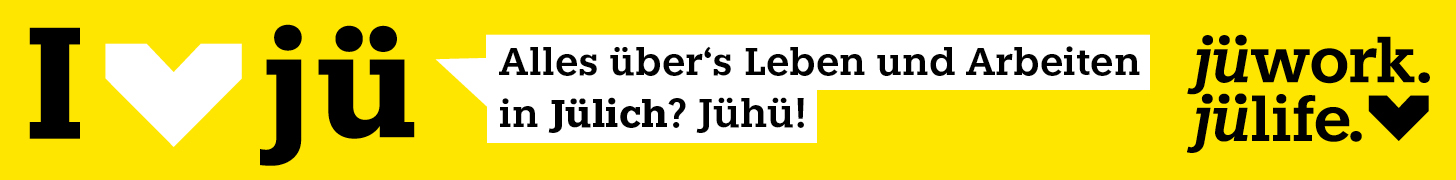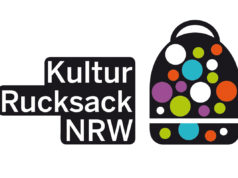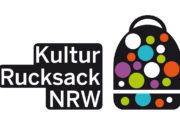Sie könnten die Arbeitswelt ähnlich verändern, wie wir es gerade bei der künstlichen Intelligenz erleben: tiefgreifend und disruptiv. Das Projekt QAIAC, dessen Kickoff-Treffen kürzlich stattfand, bringt diese beiden Schlüsseltechnologien zusammen. Forschende des Forschungszentrums Jülich arbeiten darin mit Partnern wie Mercedes-Benz, der ZF Friedrichshafen AG und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) daran, die Potenziale von Quantencomputern für KI-Anwendungen in der Automobilindustrie auszuloten.
Googles Quantenrechner „Willow“ sorgte kürzlich für Aufsehen: Eine komplexe Rechenaufgabe löste er in fünf Minuten – etwas, wofür die schnellsten heutigen Supercomputer zehn Quadrillionen Jahre bräuchten, eine Zahl mit 25 Nullen. Doch diese Aufgabe war rein akademischer Natur, ohne praktischen Nutzen. Im Projekt QAIAC stehen dagegen reale Anwendungen im Vordergrund. Obwohl Quantencomputer in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte verzeichnen konnten, befinden sie sich immer noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Für viele Aufgaben in der Industrie und mit KI ist unklar, inwieweit sie sich tatsächlich beschleunigen lassen. Denn nicht jeder theoretische Vorteil ist auch praktisch umsetzbar.
In QAIAC wollen die Forschenden mehr Erfahrungswissen gewinnen, um den praktischen Nutzen von Quantencomputern besser einschätzen zu können. Im Vorgängerprojekt Q(AI)2, das im März letzten Jahres endete, wurden in Zusammenarbeit mit mehreren großen deutschen Automobilherstellern bereits die Grundlagen für quantenbeschleunigte KI-Algorithmen gelegt. Nun geht es darum, erstmals echte Quantenvorteile anhand konkreter Anwendungen zu demonstrieren – oder zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Im Fokus stehen Optimierungsprobleme, wie die Planung von Transportrouten, Fertigungsabläufen oder die Qualitätsbewertung von Finite-Elemente-Netzen in der Produktentwicklung, mit dem Ziel, Innovationen voranzutreiben und die Entwicklung von Quantencomputern weiter zu beflügeln.
Projektkoordinator Dr. Tobias Stollenwerk vom Forschungszentrum Jülich spricht im Interview über den aktuellen Stand der Quantenforschung.
Wie weit sind die heutigen Quantencomputer?
Dr. Tobias Stollenwerk: Die Entwicklung ist äußerst dynamisch. Erste Prototypen und kommerzielle Systeme sind bereits im Einsatz: beispielsweise in Jülich, wo die Quantencomputer-Infrastruktur JUNIQ Zugang zu verschiedenen Quantensystemen bietet. Speziell die sogenannten universellen Quantencomputer befinden sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Fehlerrate ist noch zu hoch, und auch die Anzahl der Quantenbits, mit denen die Geräte rechnen, ist noch zu gering. An Googles „Willow“-Prozessor lässt sich der aktuelle Stand gut ablesen. Er besitzt 105 physikalische Qubits, die sich zu einem logischen Qubit zusammenschalten lassen. Für praktische Anwendungen benötigt man jedoch Tausende dieser fehlerkorrigierten Qubits. „Willow“ demonstrierte erstmals skalierbare Fehlerkorrektur, also eine Fehlerrate, die sich mit zunehmender Anzahl der physikalischen Qubits verbessert. Aber der Weg zur Praxis ist noch lang, da ist noch viel Raum für weitere Entwicklungen.
Wann ist mit einem industriellen Einsatz zu rechnen?
Dr. Tobias Stollenwerk: Das ist schwer vorherzusagen, aber es wird wohl noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis Quantencomputer bei einigen speziellen industriellen Aufgaben Vorteile bringen. Davon gehen heute viele Expertinnen und Experten aus. Insbesondere die Hardware, aber auch die Algorithmen, müssen erheblich weiterentwickelt werden.
Warum sollte man sich heute schon mit möglichen Anwendungen beschäftigen?
Dr. Tobias Stollenwerk: Die Fragestellungen, bei denen Quantenalgorithmen einen Vorteil gegenüber klassischen Verfahren versprechen, beruhen auf bestimmten Annahmen. Ob und inwieweit diese Annahmen auch dann zutreffen, wenn konkrete Probleme der Industrie auf Quantencomputern gelöst werden, ist nicht immer klar. Daher ist es wichtig, industrielle Anwender bereits jetzt in die Forschung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die entwickelten Verfahren auch genutzt werden können. Für Unternehmen ist es eine strategische Entscheidung, in eine Technologie zu investieren, die hohe Erträge bei gleichzeitig hohem Risiko verspricht.
Welche Anwendungen verfolgt QAIAC?
Dr. Tobias Stollenwerk: Ein Anwendungsfall ist die Fertigungsablaufplanung. In den Fabriken der ZF Friedrichshafen AG werden verschiedene Produktvarianten gefertigt. Da geht es beispielsweise um Fahrwerke oder Antriebssysteme. Mit Quantencomputern lässt sich die Planung und Reihenfolge, in der diese Varianten hergestellt werden, möglicherweise weiter optimieren. Eine andere Aufgabe ist die Transportroutenplanung für die Zulieferung von Teilen, ein klassisches Optimierungsproblem. Gemeinsam mit Mercedes-Benz werden wir außerdem erproben, wie Quantencomputer Finite-Elemente-Berechnungen verbessern können, etwa um die Verformung von Bauteilen vorherzusagen. Im Fokus steht auch das Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz. Gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI arbeiten wir an hybriden quantenunterstützten KI-Verfahren, die effizienter sein können als bisher eingesetzte Methoden.
Welche Quantencomputer kommen zum Einsatz?
Dr. Tobias Stollenwerk: Zunächst simulieren wir die Quantencomputer-Algorithmen auf herkömmlichen Computern. Anschließend untersuchen wir, inwiefern die Ausführung der Algorithmen auf echten Quantencomputern die Rechenleistung beeinflusst. Hierfür nutzen wir insbesondere solche Quantencomputer die über die JUelicher Nutzer-Infrastruktur für Quantencomputing, kurz JUNIQ, zugänglich sind. Zur Infrastruktur gehören unter anderem Geräte von D-Wave, Pasqal und Prototypen des QSolid-Projekts, das unter Federführung des Forschungszentrums Jülich einen Quantencomputer basierend auf Spitzentechnologie aus Deutschland aufbaut.